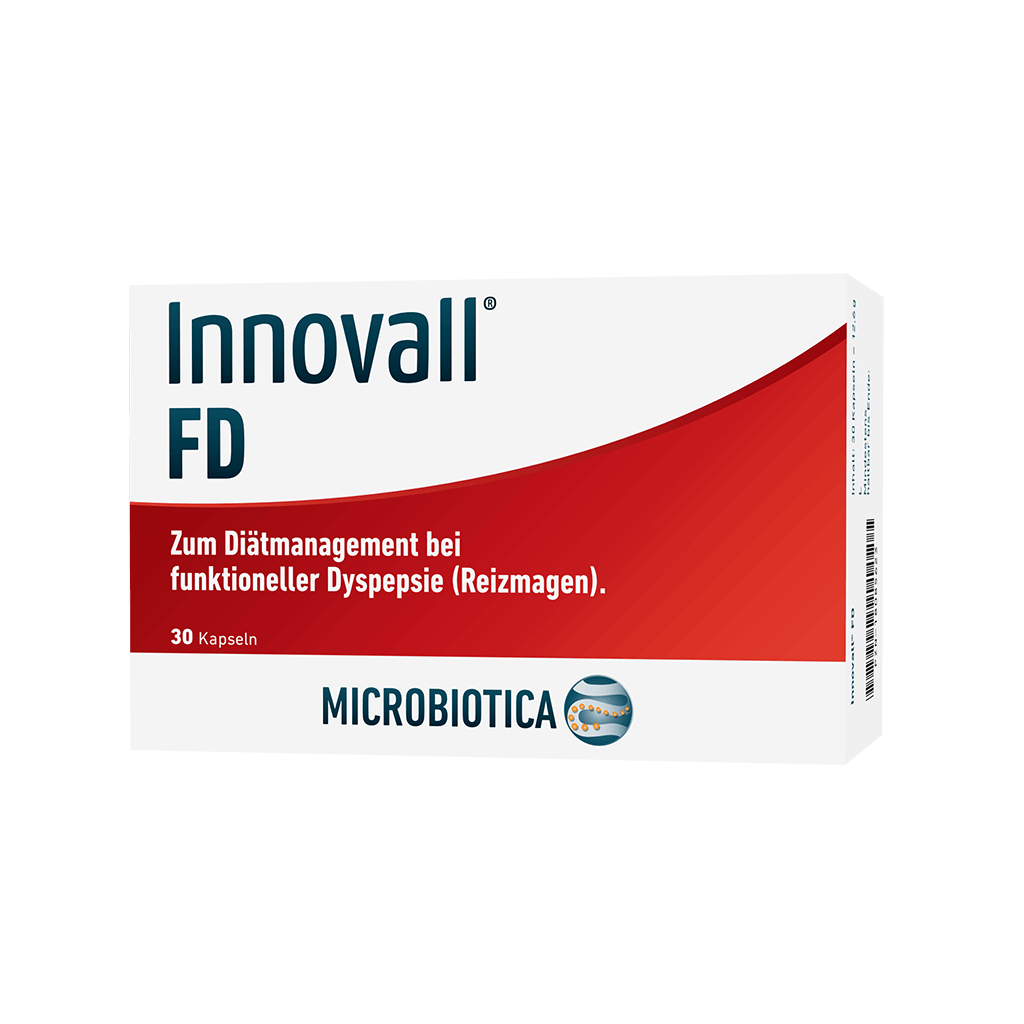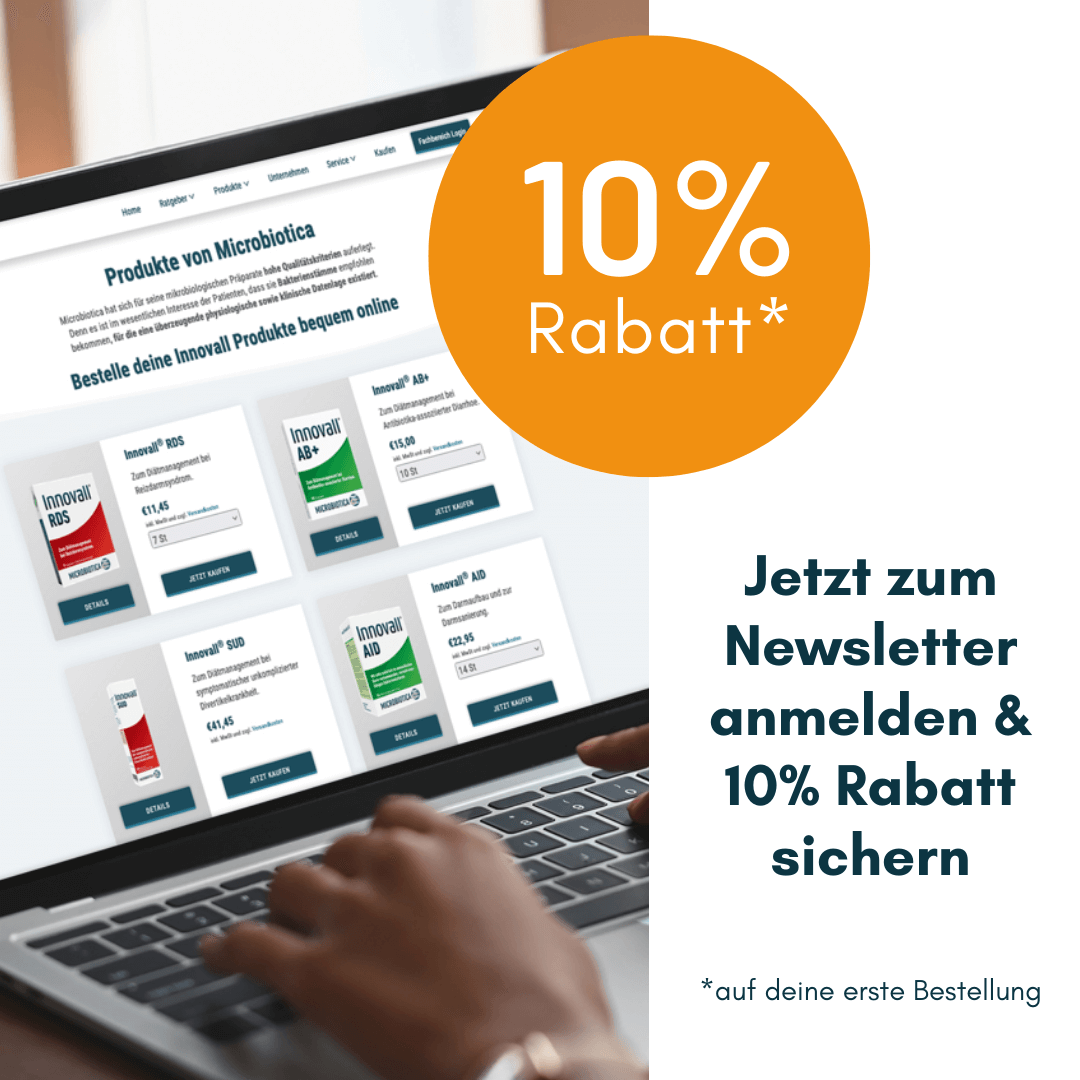Wie gefährlich sind Protonenpumpenhemmer (PPI) für die Darmflora?
Protonenpumpenhemmer (PPI) bzw. Säureblocker reduzieren Magensäure und wirken gegen Sodbrennen. Doch es gibt auch Risiken und Nebenwirkungen, denn sie haben ebenfalls großen Einfluss auf das Darm-Mikrobiom.

Das Wichtigste in Kürze:
- Protonenpumpeninhibitoren (Proton Pump Inhibitors), kurz PPI, werden umgangssprachlich auch als „Magenschutz“ oder „Säureblocker“ bezeichnet und sind Arzneistoffe, die die Bildung von Magensäure hemmen.
- PPI sind Säureblocker und werden am häufigsten bei der Refluxkrankheit, saurem Aufstoßen, Sodbrennen oder der Helicobacter pylori Behandlung eingesetzt.
- Wegen möglicher Nebenwirkungen sollte sich der Einsatz von Protonenpumpenhemmern auf gesicherte Indikationen beschränken.
- Eine abgestimmte Ernährung sowie Probiotika können verträgliche Alternativen sein und sollten die PPI Therapie begleiten, um das Darmmikrobiom zu schonen.
Das erfahren Sie in diesem Artikel:
Wirkung der PPIs
Langzeiteinnahme von PPIs
Achtung Wechselwirkungen: 5 risikoreiche Kombinationen
Risiken und Nebenwirkungen
Protonenpumpenhemmer – gefährlich für das Mikrobiom?
Säureblocker Alternativen
Unterstützung für ein geschädigtes Mikrobiom
Protonenpumpenhemmer (PPI – Proton Pump Inhibitors) Wirkung
Protonenpumpenhemmer, auch Protonenpumpeninhibitoren oder kurz PPI, sind Medikamente, die die Produktion von Magensäure unterdrücken. Umgangssprachlich werden Protonenpumpenhemmer daher auch als Magenschutz, Magensäureblocker oder Säureblocker bezeichnet. Zur Gruppe der Protonenpumpenhemmer gehören Omeprazol, Pantoprazol, Esomeprazol, Lansoprazol und Rabeprazol.1
Anders als man vielleicht denkt, wirken Protonenpumpenhemmer nach der Einnahme nicht direkt im Magen, sondern werden erst über den Darm in den Blutkreislauf aufgenommen. Über ihn gelangt er Wirkstoff zu den Zellen im Magen, in denen die Magensäure produziert wird, den sogenannten Belegzellen. Dort entfalten sie ihre Wirkung, in dem sie die „Protonenpumpen“ blockieren, sprich: die Ausschüttung von Protonen in den Magen hemmen. Protonen sind positiv geladene Teilchen, die sich im Magen zusammen mit Chlorid zu Salzsäure, der Magensäure verbinden. Die Gleichung ist einfach: Keine Protonen = keine Magensäure.
Protonenpumpenhemmer (PPI) Anwendung

PPI, wie Omeprazol, sind daher am effektivsten, wenn die Konzentration von Protonenpumpen in den Belegzellen am höchsten ist, was vor allem nach einer längeren Fasten-Periode der Fall ist. Aus diesem Grund soll die Einnahme eines PPI morgens vor dem Frühstück stattfinden. Das Frühstück spielt noch eine weitere wichtige Rolle: Da nur eine aktivierte Protonenpumpe blockiert werden kann und deren Aktivierung durch Nahrungsaufnahme stattfindet, ist es wichtig, ungefähr 30 Minuten nach Einnahme des PPI tatsächlich auch zu frühstücken.2
Die morgendliche Einnahme sollte auch dann durchgeführt werden, wenn die Beschwerden nur abends auftreten, da die Wirkung von PPI länger als 24 Stunden anhält. Nicht alle Belegzellen werden während einer Mahlzeit aktiviert, und nicht alle Protonenpumpen werden nach einer Dosis PPI blockiert. Erst nach 5 Tagen mit täglicher Einnahme eines PPI wird der maximale Säureausstoß um ca. 66% gehemmt.2 Dies sollte bei der Selbstmedikation bedacht werden.

Protonenpumpenhemmer Einnahme
PPI sind die Mittel der Wahl zur Hemmung der Magensäureproduktion und werden u.a. im Zusammenhang mit der Gastroösophagealen Refluxkrankheit, saurem Aufstoßen, Sodbrennen) oder oft als Magenschutz mit Schmerzmitteln wie Ibuprofen verschrieben. Eine klinische Wirksamkeit haben PPI, wie Omeprazol, jedoch nur in einigen wenigen Fällen. Dazu gehören die Refluxkrankheit, die Ulkuskrankheit und die Behandlung einer Helicobacter pylori-Infektion.
Eine Refluxkrankheit oder eine Refluxösophagitis (einer Entzündung der Speiseröhre mit Schleimhautveränderung) tritt auf, wenn säurehaltiger Mageninhalt in die Speiseröhre zurückfließt. Dies geschieht, wenn der Schließmuskel zwischen Magen und Speiseröhre, der diesen Rückfluss normalerweise verhindert, nicht richtig funktioniert. Warum es zu solch einer Schwächung des Schließmuskels kommt, ist nicht abschließend geklärt. Im Verdacht stehen ein ungesunder Lebensstil mit dem Konsum von zu fetten Speisen, Nikotin (Rauchen), Alkohol und zu viel Kaffee. Auch Stress, Übergewicht und die Einnahme von Medikamenten können Magen-Darm-Probleme inklusive der Refluxkrankheit begünstigen. Das Leitsymptom ist ein brennender Schmerz in der Brust (Sodbrennen), es können sich jedoch auch Schluckstörungen, Druckgefühle und verschiedene andere Beschwerden zeigen.3,4
Neben der Linderung von Sodbrennen, finden Protonenpumpenhemmer in der Medizin außerdem Anwendung zur Behandlung von Helicobacter pylori-Infektionen, die zu Magenschleimhautentzündungen oder auch Folgeerkrankungen wie Magen-Darm-Geschwüren führen können.5 Mittlerweile werden PPI auch häufig als Magenschutz bei der Einnahme von Schmerzmitteln (Ibuprofen, ASS) eingesetzt. Diese Vorsorge-Empfehlungen gelten jedoch nur für Risikopatienten: Alter > 65 Jahre, Ulkus in der Vorgeschichte, Behandlung mit Kortikosteroiden oder Helicobacter-Besiedlung.6

Hier sind Säureblocker fehl am Platz
PPI mindern die Säureproduktion im Magen (was zur Linderung von Beschwerden wie Sodbrennen und Völlegefühl beiträgt). Problematisch bei der Einnahme der nicht-verschreibungspflichtigen Protonenpumpenhemmer ist, dass Patienten diese oft leichtfertig und bei den falschen Indikationen einsetzen. So trägt zum Beispiel die reduzierte Magensäure bei Patienten mit einem sogenannten Reizmagen-Syndrom nicht zur Heilung bei, sondern verstärkt im Gegenteil säurebedingte Refluxsymptome wie Sodbrennen oder saures Aufstoßen. Dadurch wird bei Patienten eine künstliche Abhängigkeit von Protonenpumpenhemmern erzeugt, denn sie nehmen dagegen wiederum PPI ein.7
Wenn Schmerzmittel eingenommen werden müssen, wird oft gleich ein PPI als Magenschutz dazu verordnet. Sofern man nicht zu einer Risikogruppe gehört (Alter über 65 Jahre, andere Begleiterkrankungen des Magen-Darmtrakts) ist dies in der Regel jedoch nicht notwendig.
Auch für die Behandlung von Magenschleimhautentzündung (Gastritis) und Zwölffingerdarm-Entzündung (Duodenitis) sind die verschreibungspflichtigen PPI nicht zugelassen.8 In Krankenhäusern werden PPI auch oft als allgemeine Vorsorge bei Schmerzmittel-Gabe eingesetzt. Leider wird bei der Entlassung häufig vergessen, das Medikament wieder abzusetzen. So sind Betroffene häufig im Glauben, es handle sich um eine Dauertherapie.6 Die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten e.V. empfiehlt deshalb, dass eine Dauermedikation nur unter ärztlicher Betreuung und bei klar abgesicherter Diagnose erfolgen sollte.9 Sicher ist: Magensäure ist für eine reibungslose Verdauung essentiell; ein Eingriff in die Produktion von Magensäure sollte daher nie leichtfertig erfolgen.

Protonenpumpenhemmer Langzeiteinnahme
Der Einsatz von Protonenpumpenhemmern (PPI) hat in den letzten Jahren stark zugenommen.10,11 In den vergangenen zehn Jahren haben sich die PPI-Verordnungen mehr als verdoppelt, was nicht daran liegt, dass auch die säurebedingten gastrointestinalen Erkrankungen zugenommen haben. Lange waren PPI rezeptpflichtig und man musste stets einen Arzt aufsuchen, ehe man das Medikament in der Apotheke erhalten hat. Inzwischen sind viele Protonenpumpenhemmer Präparate rezeptfrei auch zur Selbstmedikation in der Apotheke erhältlich.1 Vermutlich werden Protonenpumpenhemmer daher auch bei Krankheiten oder Beschwerden eingesetzt, für die keine wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung vorliegt (siehe Hier sind Säureblocker fehl am Platz).12
Ein zweiter Grund für den enormen Anstieg des PPI-Einsatzes ist, dass die gezielte Beendigung der Therapie oft nicht eingeleitet wird, und es so zur Langzeiteinnahme kommt. Das Absetzen nach längerer Einnahme ist jedoch manchmal gar nicht so leicht, da es durch die Zunahme der Magensäure zu einer kurzzeitigen Verschlimmerung der Magenbeschwerden (vor allem Sodbrennen) kommen kann (med. symptomatischer Säurerebound). Daher sollte eine Langzeiteinnahme nicht abrupt, sondern ausschleichend über längere Zeit beendet werden (siehe Protonenpumpeninhibitoren absetzen).13
Bedenklich ist die oft leichtfertige Einnahme von PPI, da durch die Verwendung von Protonenpumpenhemmern Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt auftreten können und es zu einer negativen Beeinflussung des Darmmikrobioms kommen kann.
Newsletteranmeldung
Fast geschafft! Bestätigen Sie kurz die E-Mail, die Sie erhalten haben.
Bitte überprüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner, sollten Sie die E-Mail nicht erhalten haben.
PPI Wechselwirkungen: 5 risikoreiche Kombinationen
Protonenpumpeninhibitoren (PPI) erhöhen den pH-Wert im Magen. Über diesen Mechanismus kann aber auch die Aufnahme und damit die Bioverfügbarkeit anderer Medikamente und wahrscheinlich auch von Nahrungsbestandteilen beeinflusst werden. Eine unnötige PPI-Einnahme sollte deshalb vermieden werden. Denn diese Wechselwirkung kann unter Umständen negative Folgen auf entsprechende Behandlungen haben.14 Medikamente mit denen PPI eine Wechselwirkung gezeigt hat, sind unter anderem:
- Antibiotika. Wenn Antibiotika, wie Ampicillin oder Cefpodoxim, die Magen-Darm-Passage nicht passieren können, wird die Bioverfügbarkeit gesenkt und sie bleiben wirkungslos.6
- HIV-und Krebstherapeutika: Verminderte Aufnahme u.a. von Atazanavir, Ritonavir, Indinavir, Fosamprenavir, Tipranavir, Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI), Dasatinib, Bosutinib, Nilotinib, Erlotinib und Pazopanib.15
- Schilddrüsenhormone: Die Aufnahme von L-Thyorxin-Präparaten ist pH-abhängig. Die Wechselwirkungen zwischen L-Thyroxin und PPI können unter Umständen eine Dosiserhöhung des Schilddrüsenhormons erforderlich machen.16
- Calcium und Magnesium und Vitamine: PPI können durch pH-Senkung die Aufnahme von Calcium, Magnesium, Eisen, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) und Vitamin D, mindern. Sicherheitshalber sollte bei Patienten unter PPI-Therapie bei Verdacht eine Überwachung der der Blutspiegel Mg-Werte durchgeführt werden.6,12,15
- Clopidogrel: Dieses Medikament wird zur Therapie und zur Vorbeugung gegen die Bildung von Blutgerinnseln verwendet. Die gleichzeitige Einnahme PPI könnte möglicherweise die Wirkung von Clopidogrel hemmen.17
Protonenpumpenhemmer Risiken und Nebenwirkungen
Auch wenn die Einnahme von Protonenpumpenhemmern bzw. Säureblockern in der Regel als sehr sicher gilt, sollte zu dieser Behandlung nur bei passenden Diagnosestellungen gegriffen werden. Denn die Einnahme von Protonenpumpeninhibitoren kann mit teils erheblichen Risiken und Nebenwirkungen einhergehen. Häufig sind Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Verstopfung, Durchfall, Blähungen, Übelkeit/Erbrechen.18 Auch wenn teilweise nicht ganz klar ist, was genau die Ursache ist, führte die langfristige PPI-Einnahme in Studien bei einigen Patienten außerdem zu einem erhöhten Risiko von:19,20,21
- Mikronährstoffmangel (Verminderte Aufnahme durch reduzierten pH-Wert)
- Nierenerkrankung
- Demenz
- Knochenbrüche
- Herzinfarkte
- Bakterielle Fehlbesiedelung im Dünndarm (durch Störung des Mikrobioms)
- Campylobacter oder Salmonella Darm-Infektion (durch Störung des Mikrobioms)
- Clostridium difficile Infektion (durch Störung des Mikrobioms)
- Spontane bakterielle Peritonitis
- Lungenentzündung
- Gastrointestinale Malignome (v.a. Magen, Speiseröhre)

Protonenpumpenhemmer – gefährlich für das Mikrobiom?
Neben den gerade beschriebenen Risiken und Nebenwirkungen von Protonenpumpenhemmern, wie Omeprazol und Pantoprazol, sind bei langfristiger Einnahme auch Folgen für das Darmmikrobiom (auch: Darmflora) möglich. Denn das veränderte pH-Milieu im Magen kann sich langfristig auch auf die gesamte pH-Wert-Verteilung im gastrointestinalen Bereich ausdehnen und dort zu einer bakteriellen Fehlbesiedelung führen. In mehreren wissenschaftlichen Studien wurde unter PPI-Gabe eine sinkende bakterielle Diversität festgestellt.11
Die Produktion der Salzsäure im Magen führt im Magensaft zu einem pH-Wert zwischen 1,5 und 3,2. Durch PPI kann der Wert auf pH 5 angehoben werden. Das ist zwar für die Behandlung erwünscht, hat aber auch negative Auswirkungen. Zum einen dient die Säure als Vorverdauung von Nahrungsbestandteilen (z.B. Eiweiß), und zum anderen dient sie dazu unerwünschte Keime abzutöten. Ist der Magen nicht mehr so sauer, können sich ungünstige Bakterien ansiedeln, die normalerweise erst im Dickdarm ihren Platz haben sollten. Man spricht dann von einer bakteriellen Fehlbesiedelung bzw. einer gestörten Zusammensetzung der Mikrobiota (Dysbiose).22
Säureblocker und Dünndarmfehlbesiedlung (SIBO): Was Sie wissen sollten Es gibt zunehmend wissenschaftliche Erkenntnisse über eine mögliche Verbindung zwischen der langfristigen Anwendung von Säureblockern und einem „Small Intestinal Bacterial Overgrowth“ (SIBO), also einer Dünndarmfehlbesiedlung.23
Was ist SIBO? Normalerweise ist der Dünndarm relativ bakterienarm, während die meisten Darmbakterien im Dickdarm zu finden sind. Bei SIBO siedeln sich jedoch vermehrt Bakterien im Dünndarm an, was zu verschiedenen Magen-Darm-Beschwerden führen kann.
Die Verbindung zwischen PPI und SIBO: Studien haben gezeigt, dass die langfristige Anwendung von PPI das Risiko für SIBO erhöhen kann. Die Reduzierung der Magensäureproduktion durch PPI verändert die saure Umgebung im Magen, die normalerweise dazu dient, schädliche Bakterien abzutöten. Wenn diese schädlichen Bakterien den Magen passieren und den Dünndarm erreichen, kann dies das empfindliche Gleichgewicht der Darmflora stören und zu SIBO führen.
Was sollten Sie tun?
- Kurze und sachgerechte Anwendung: Verwenden Sie PPI nur, wenn sie ärztlich verordnet wurden, und befolgen Sie die Anweisungen genau. PPI sollten nicht länger als nötig eingenommen werden, und die Dosierung sollte so niedrig wie möglich sein.
- Achten Sie auf Symptome: Wenn Sie langfristig PPI einnehmen oder bereits an Magen-Darm-Beschwerden leiden, sollten Sie auf mögliche Anzeichen von SIBO oder einer gestörten Darmflora achten, darunter Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall.
- Konsultieren Sie einen Arzt: Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von PPI auf Ihre Darmgesundheit haben oder Symptome von SIBO vermuten, sollten Sie sich an einen Arzt wenden. Eine frühzeitige Diagnose per H2-Atemtest und angemessene Behandlung sind wichtig, um weitere Komplikationen zu verhindern.
- Probiotika in Betracht ziehen: Die Ergänzung mit einem Magen-spezifischen Microbioticum, wie Innovall® FD, kann eine sinnvolle Maßnahme sein, um die Darmflora zu unterstützen und eine SIBO zu verhindern.
Protonenpumpenhemmer und Clostridium difficile
Ein gestörtes Mikrobiom des Verdauungstraktes spielt eine wichtige Rolle in der Entstehung von Darm-Infektionen. Daher ist es einleuchtend, dass der enorme Einfluss von Protonenpumpeninhibitoren auf die Zusammensetzung der Mikrobiota, mit einem erhöhten Risiko für Darminfektionen, vor allem durch Clostridium difficile, in Zusammenhang steht.24 Clostridium difficile Infektionen gehen teils mit schweren Durchfällen einher und können ständig wiederkehrend und schwer verlaufend sehr gefährlich werden – lesen Sie hier mehr über Clostridium difficile-Infektionen und deren Behandlung. Um die Darmflora zu schützen und eine Infektion zu vermeiden kann ein ausgewähltes Microbioticum, wie Innovall® CDI, als präventive Maßnahme bei gefährdeten Antibiotika-Patienten helfen.
Protonenpumpenhemmer absetzen
Protonenpumpenhemmer sollten bei einer Einnahme von mehr als drei Wochen nicht abrupt abgesetzt werden, um z.B. das Auftreten von erneuten Sodbrennen-Episoden (Reboundsymptome) zu vermeiden. Alternativ wird das Ausschleichen der Protonenpumpenhemmer empfohlen – es kann Wochen bis Monate dauern, bis PPI sicher abgesetzt werden. Als Faustregel gilt: Je länger der Zeitraum der PPI Einnahme war, umso länger dauert das Absetzen.24

Ihr Hausarzt, Facharzt oder Apotheker wird Sie gerne zu einem gesunden Absetzen der Protonenpumpenhemmer beraten.
Säureblocker Alternativen
Protonenpumpenhemmer können nachweislich unerwünschte Wirkungen und negativen Einfluss auf das Darm-Mikrobiom haben.23 Es gibt jedoch auch natürliche und nebenwirkungsfreie Alternativen als Säureblocker:
- Alternativ-Arzneimittel: Antazida, Mittel auf Alginat-Basis, H₂-Antihistaminika
- Hausmittel zur Reduktion von Magensäure:
- Pflanzliche aber auch proteinreiche Ernährung (Achtung Veganer!). Kohlenhydrate besser reduzieren.
- Apfelessig: Klingt erstmal kontraproduktiv, Apfelessig enthält aber alkalische Mineralien, die die Magensäure neutralisieren.
- Das Kauen von Nüssen soll die Magensäure neutralisieren.
- Kräutertee: z.B. Fenchel oder Kamille
- Kaugummi kauen regt die Speichelproduktion an – die Spucke kann Magensäure neutralisieren und die Speiseröhre schützen.
- Stress reduzieren
- Magensäure-Mangel überprüfen: Ein Magensäuremangel äußert sich mit ganz ähnlichen Symptomen wie ein Magensäureüberschuss und ist insbesondere bei Menschen ab 50 eine häufige Ursache für Magenbeschwerden.
Mikrobiotika: Unterstützung für ein geschädigtes Mikrobiom
Es ist mittlerweile bekannt, dass viele Medikamente, darunter Antibiotika und Säureblocker wie Omeprazol, Esomeprazol und Pantoprazol, die Zusammensetzung der Darmflora beeinflussen können. Säureblocker, obwohl effektiv bei der Behandlung von Magenproblemen wie Sodbrennen und Magengeschwüren, reduzieren die Magensäure und verändern die saure Umgebung im Magen, die normalerweise schädliche Bakterien abtötet. Dies kann zu Ungleichgewichten in der Darmflora führen.28,29,30
Da PPI teilweise ohne Rezept erhältlich sind, nutzen viele Menschen sie zur Selbstmedikation, oft ohne klare Diagnose. Allerdings sollte man aufgrund neuer Erkenntnisse über die Auswirkungen auf die Darmflora vorsichtiger sein. Viele Ärzte empfehlen daher immer mehr Zurückhaltung bei der Verschreibung und Selbstmedikation. Und wenn PPI notwendig sind, sollte die Dosierung so niedrig und die Behandlungsdauer so kurz wie möglich sein. Für Patienten, die auf eine Suäureblocker-Therapie angewiesen sind, kann dann in vielen Fällen die Einnahme von spezifischen Probiotika sinnvoll sein, um die Darmflora zu unterstützen, Verdauungsproblemen vorzubeugen oder die Darmflora langfristig wiederherzustellen. Die Auswahl des richtigen Probiotikums und die richtige Dosierung sind jedoch entscheidend, um eine individuell angepasste Behandlung, die die spezifischen Bedürfnisse berücksichtigt, sicherzustellen.31
- Langzeitgebrauch von Protonenpumpenhemmern: Die langfristige Einnahme von PPI, z. B. zur Behandlung von Sodbrennen, Reflux, Magengeschwüren und ähnlichen Magenproblemen, kann u.a. das Risiko von „Small Intestinal Bacterial Overgrowth“ (SIBO), also einer Dünndarmfehlbesiedlung, erhöhen. Es ist daher ratsam, PPI nach ärztlicher Absprache nicht länger als 3 Monate einzunehmen und die Therapie schrittweise zu beenden. Zur Minimierung von Reboundsymptomen durch die gesteigerte Magensäureproduktion kann ein auf Magensymptome zugeschnittenes Microbioticum wie Innovall® FD eine hilfreiche Ergänzung sein.
- Säureblocker bei Reizmagen: Säureblocker werden auch oft bei Reizmagen-Symptomen empfohlen, können jedoch aufgrund von Veränderungen in der Darmflora neue tieferliegende Verdauungsprobleme wie Blähungen, Durchfall oder Verstopfung verursachen. Ein spezielles Microbioticum für Reizmagen, wie Innovall® FD, kann helfen, das Mikrobiom zu stabilisieren, eine Dünndarmfehlbesiedlung (SIBO) zu verhindern und Reizmagenbeschwerden zu lindern.
- Säureblocker als „Magenschutz“: Oft werden Säureblocker als sogenannter „Magenschutz“ eingesetzt, um die Magenschleimhaut bei Einnahme von magenschädigenden Medikamenten (wie Kortison oder spezielle Schmerzmittel) zu schützen. Während sie effektiv Magenprobleme verhindern können, sollten Sie sich bewusst sein, dass die langfristige Verwendung von Säureblockern die Darmflora beeinflussen kann. Um dieser Herausforderung entgegenzuwirken und die Darmgesundheit zu erhalten, kann die Ergänzung mit einem geeigneten Magen-spezifischen Microbiotcum, wie Innovall® FD, empfehlenswert sein.
- Säureblocker und Antibiotika: Die Beeinträchtigung der Darmflora durch PPI und Antibiotika kann in einigen Fällen schwerwiegender sein und zu Komplikationen und Infektionen führen. Säureblocker stehen mit Antibiotika im Verdacht das Risiko für eine schwere Darmentzündungen durch Clostridium difficile zu erhöhen. In solchen Situationen der Einsatz eines ausgewählten Microbioticums, wie Innovall® CDI, als präventive Maßnahme bei Risikopatienten betrachtet werden.32 Ärzte empfehlen bereits ab dem 1. Tag der Antibiotika-Behandlung damit zu beginnen. Auch bei Menschen ohne Risikoprofil ist der Schutz der Darmflora während einer Antibiotika-Therapie sinnvoll, unabhängig ob gleichzeitig Säureblocker eingenommen werden. Hier hat sich ein speziell dafür entwickeltes Microbioticum, wie Innovall® AB+, bewährt.
Darmflora aufbauen mit Innovall®
Mit Innovall® erhalten Sie spezifisch ausgewählte, hochdosierte mikrobiologische Präparate, die die Darmflora in besonderen Situationen nachhaltig erreichen und zum Positiven verändern können.
Ihr Expertenteam von Innovall® oder Ihr/e Apotheker/in berät Sie gerne zu den Produkten von Innovall®.
| Tipps zur Therapie mit PPI |
| 1: PPI nur dann einnehmen, wenn sie vom Arzt verschrieben worden sind und auch nur so lange wie nötig. Am besten unter ärztlicher Aufsicht. |
| 2: Zu Schmerzmitteln muss man nicht immer PPI einnehmen (nur Risikogruppen). |
| 3: PPI zeigen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und mit der Nährstoffaufnahme. |
| 4: PPI haben einen großen Einfluss auf das Mikrobiom. Bei langfristiger Einnahme ist ein Darmflora-Aufbau sinnvoll. |
Häufige Fragen und Antworten:

Ist Ranitidin ein Protonenpumpenhemmer?
Ranitidin ist zwar ebenso wie Protonenpumpenhemmer ein Magen-Darm-Mittel, das zur Verringerung von Magensäure eingesetzt wird, jedoch ist die Wirkweise eine andere. Bei Ranitidin handelt es sich um einen sogenannten Histamin-H2-Rezeptorblocker (auch: H2-Antihistaminikum), der auf die histaminabhängige Produktion der Salzsäure im Magen und die Freisetzung des Verdauungsenzyms Pepsin wirkt. Ranitidin findet Anwendung zur Behandlung von Refluxkrankheiten wie Sodbrennen und zur Prophylaxe von Magengeschwüren.

Wie schnell wirken Protonenpumpenhemmer?
PPI sind am effektivsten, wenn die Konzentration von Protonenpumpen in den Belegzellen am höchsten ist, vor allem also morgens vor dem Frühstück. Die Wirkung ist abhängig von der Nahrungsaufnahme, weshalb es wichtig ist, mind. 30 Minuten nach der PPI-Einnahme zu frühstücken.2 Die Wirkung von PPI lindert die Beschwerden nicht unmittelbar, sondern wirkt über einige Tage – nach ca. 5 Tagen ist meist der maximale Effekt erreicht. Dies sollte bei der Selbstmedikation bedacht werden.

Was ist die Pantoprazol Standarddosis und wie wird es eingenommen?
Die Einnahmen des Medikamentes Pantoprazol sollte nur nach vorheriger Absprache mit dem Arzt eingenommen werden. Die Standarddosis beginnt in der Regel bei 40mg pro Tag und kann bei Misserfolg der Therapie gesteigert werden. Pantoprazol wird unzerkaut am besten mit einem Glas Wasser vor einer Mahlzeit geschluckt.